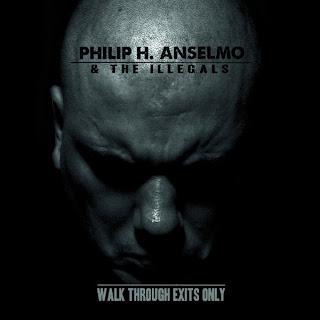Info
Bandname: Amorphis
Albumname: Circle
Musikrichtung: Metal
Erscheinungsjahr: 2013
Label: Nuclear Blast
Herkunft: Finnland
Facebook: www.facebook.com/amorphis
Website: www.amorphis.net
Es gab mal Zeiten, da war die bloße Ankündigung einer neuen AMORPHIS-Platte allein schon Grund zur Freude und man war wahnsinnig neugierig, welche konkreten musikalischen Pfade die wandelfähigen Finnen wohl diesmal beschreiten werden.
Alben wie „Tales From The Thousand Lakes“, „Elegy“, „Tuonela“ oder der Neuanfang „Eclipse“ wussten mehr als zu begeistern und waren jeweils so unterschiedlich zueinander, wie es nur sein kann. Allein die typische Melodieführung und Atmosphäre ließ erkennen, dass es sich bei all den Alben um die gleiche Band handelt.
Seit ein paar Jahren ist dem nicht mehr so, leider!! Laut eigenen Angaben habe man nun den eigenen unverkennbaren Stil gefunden und erwägt keinerlei drastische Experimente mehr auszuführen. An sich geht das völlig in Ordnung, nur drehten sich AMORPHIS auf den letzten regulären Studioalben so ziemlich im Kreis und traten vehement auf der Stelle. Nur knapp entkamen sie der Gefahr zur eigenen Karikatur zu werden, mal ganz drastisch ausgedrückt. Verkleisterte klebrige Keyboardklänge, gefällige verschmuste Schmachtrefrains, zarte Frauenstimmchen zur Ergänzung und zu allem Überfluss das unverfrorene Selbstkopieren.
Nun kommt ein Album heraus, was auf den Namen „Circle“ getauft wurde. Was soll man nun davon erwarten…Nomen est omen?
Im Vorfeld der Veröffentlichung konnte man so Einiges lesen. Die Band würde zurück zur alten Härte finden und dergleichen mehr. Wie sieht denn nun die Realität aus? (Natürlich anders, zumindest wenn man sich mehr als nur den ersten Song anhört, um sich sein Urteil zu bilden….)
Der Opener „Shades of grey“ startet schon mal ziemlich vielversprechend. Growls und volles Brett, schön klirrende Gitarren. Im Strophenhintergrund kann man leichte Anklänge einer Sitar erkennen, passt alles wunderbar. Der Refrain wird im Klargesang dargeboten und ist verhalten melodisch, also eingängig genug dennoch nicht zu aufdringlich. Das Stück versprüht Kraft und Energie. Was sicherlich auch dem Mix zu verdanken ist, denn die Keyboards sind stark in den Hintergrund gepackt und die Gitarren dominieren das Feld. Ein guter Song, der mich in Verzückung und Vorfreude versetzt.
Haben AMORPHIS tatsächlich die Reißleine gezogen und das Zuckerverklebte aus Ihrem Soundgewand gebürstet? Scheint ganz so!
Oder doch nicht? „Mission“ zeigt schon die ersten Schwächeanzeichen und schippert im Fahrwasser der letzten Alben. Seichte Keyboards, gefällige Atmosphäre, keine Growls und jede Menge melodischer Klargesang. Die triolischen Gitarrenleads, die im Prinzip ein Markenzeichen der Band sind, fehlen auch nicht.
Seichter Einstieg und Anklänge von Cello ebnen den Weg für „The wanderer“. Kurz darauf rockt man sehr refrainlastig und mit jeder Menge Melodie. Ich muss jedoch zugeben, dass mir dieses Stück durchaus gefällt und obwohl der Refrain sehr eingängig ist, weiß er zu gefallen und hängt sich souverän im Gehörgang fest. Der Song lebt davon, Experimente oder Überraschungen gibt es keine.
Flöten leiten „Narrow path“ ein. Diese Folkelemente stehen dem AMORPHIS-Sound gut und zwar seit jeher. Nur könnten sie das meiner Meinung nach wieder wesentlich konsequenter durchziehen. Sonst schlürft der Song so vor sich hin. Refrain und Strophen wechseln sich (streng nach Lehrbuch) schön ab und auch sonst geht man sehr auf Nummer sicher. Positive Grundstimmung, tanzbare Melodien. So etwas hat man von AMORPHIS schon des Öfteren hören können. Kein Totalausfall, aber auch kein Grund für tosenden Beifall.
Der brachiale Anfang von „Hopeless days“ mit drückender Doublebass lässt mich da schon eher aufhorchen. Doch kurz ist das Vergnügen, schon vermiest uns ein zartes Pianostückchen und verletzlicher Klargesang etwas die Stimmung. Synthieschwaden ziehen im Hintergrund gemächlich ihre Kreise. Auf den markanten melodieverliebten Refrain muss man nicht allzu lange warten, auf Growls jedoch vergeblich. Man sieht sich hier einem ständigen Wechsel von aufschwellender Wucht und gediegener Atmosphäre ausgesetzt. Grundsätzlich alles nicht verkehrt, aber gerade von AMORPHIS doch schon oft genug intoniert.
Ich frage mich in dem Zusammenhang nun ernsthaft, wie bei den Jungs die Proben ablaufen. Die müssen sich doch mittlerweile langweilen immer das gleiche Muster abzududeln? Oder komponiert man bewusst so, um gar nicht erst Proben zu müssen? Pure Spekulation!
„Nightbird’s song“ wartet mit einem typischen Songanfang aus dem Fundus der Finnen auf und mausert sich zum kraftvollen Brett mit energiegeladenen teils keifenden Growls. Im Mittelteil erwartet den Zuhörer ein atmosphärischer Moment mit Flöteneinsatz. Aber trotzdem kommt man bei diesem Song auch nicht um den dominanten Refrain herum, der zum Ende hin auch noch etwas zu sehr ausgewalzt wird. Immerhin trotz allem mit eines der besten Stücke vom Album.
Mit „Into the abyss“ erfindet man sich ebenfalls nicht neu und setzt auf Bewährtes. Seichtes Keyboardgeplänkel, dazu passender Klargesang und Stakkatogitarren. Überlagert wird das alles wieder von einem melodischen Refrain. Grenzwertig ist aber das synthetisch verkleisterte Keyboardsolo. Nicht zu vergessen. Refrain, Refrain und nochmals Refrain.
Das können die doch verdammt noch mal besser. Was ist denn nur los mit denen?
Herrlich zähfließend bahnt sich „Enchanted by the moon“ seinen Weg. Im Wesentlichen basiert der Song auf dem Wechsel der hämmernden schleppenden Strophen mit fiesen Growls und dem positiv geladenen Refrain, welcher natürlich mit schmachtendem Klargesang zelebriert wird. Absolut nichts Neues im AMORPHIS-Universum.
Es wäre langsam mehr als angebracht, dass sie den alten abgenutzten Schnittmusterbogen endlich über Bord schmeißen und wieder ausm Bauch heraus komponieren, statt am Reißbrett zu entwerfen. Nur wer gibt Ihnen den nötigen Klaps auf den Hinterkopf?
Nochmal etwas Folkfeeling wird bei „A new day“ eingebettet. Sehr atmosphärische Strophen reihen sich an den mittlerweile AMORPHIS-typischen Schunkelrefrain. Ein weiteres Mal findet die Flöte im Klangbild Verwendung, dass sind Momente, die mir richtig Freude bereiten bevor im Outro noch kurz ein Saxophon erklingt.
Der erste Bonustrack ist mit „Dead man’s dream“ zugleich auch das schnellste Stück der Platte und zu recht nur auf der Ersatzbank zu finden. Druckvoll scheppernd mit Growls, Gekeife und dem obligatorischen Sing-Sang-Chorus. Der Tritt in die Weichteile kommt hier in Form eines absolut eklig klingenden Keyboardsounds im Soloteil. Pfui Deibel!
Als spezieller Bonustrack für die Vinyl-Pressung wurde „My future“ auserwählt und dabei hat die Band einen Fehler gemacht, denn der Song gehört meiner Meinung nach aufs reguläre Werk. Zwar handelt es sich dabei nicht um ein unverzichtbares Meisterwerk, schlägt aber einen Großteil des auf „Circle“ befindlichen Materials um Längen.
Seichter anschwellender atmosphärischer Anfang. Kurz blitzt eine an THE DOORS angelehnte Orgelklangfarbe auf. Die Melodieführung ist klassisch AMORPHIS, aber in der Strophe stehen sich Piano, Akustikgitarre und verzerrte Klampfen gegenüber und dies bietet eine schöne Klangtiefe. Drummer Jan geht sehr vielseitig und dynamisch über die Kessel. Selbst der Refrain ist nicht zu aufdringlich. Man schickt den Hörer durch verschiedene Passagen unterschiedlichster Stimmungen. Durchaus interessant. Einer der Höhepunkte des Albums findet also erst in der Verlängerung statt.
Fazit:
Auch wenn sich „Circle“ im Kleinen wieder etwas in eine positivere Richtung entwickelt hat, ist es doch irgendwie noch zu unausgegoren. Zu sehr spielt die Band auf Sicherheit und hängt in ihren eigenen Fußstapfen fest. In Ansätzen sind die Songs ja auch gut, nur möchte ich bitte nicht andauernd von diesen eingängigen Wohlfühlrefrains angefallen werden, nicht bei jedem Song! Das mag zwar eventuell der Akzeptanz bei einem breiteren Publikum zuträglich sein, verschleiert aber vollends die eigentlichen Qualitäten dieser Band.
Zudem haben sie mit Tomi Joutsen einen eigentlich wunderbaren grandiosen Sänger in ihren Reihen, der sowohl hammerharte Growls als auch gefühlvollen Klargesang problemlos bewältigen kann. Doch das Growlen findet viel zu selten statt, für meinen Geschmack. Dann kommt noch hinzu, dass er neuerdings im Klargesang irgendwie so einen weinerlichen Unterton entwickelt hat, was mir auf Dauer nicht so richtig schmeckt.
Wie gesagt, grundsätzlich kann man sich das neue Album durchaus anhören, wie die Vorgänger auch. Nur sind es eben keine Großtaten und die wirklich herausragenden Songs sind klar in der Minderzahl, der Rest ist leider nur mäßige Durchschnittskost.
Vielleicht sollten die Herren eine Kreativpause einlegen, um sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und wieder mehr packende Zeugnisse der Tonkunst zu erschaffen.
Für mich bleibt also vorerst „Eclipse“ weiterhin das Referenzwerk der Joutsen-Ära.
Schade eigentlich!!
Anspieltipps: „Shades of grey“, „The wanderer“, „Nightbird’s song“, „My future”
Bewertung: 5 von 10 Punkten
Tracklist:
01.Shades of grey
02.Mission
03.The wanderer
04.Narrow path
05.Hopeless days
06.Nightbird’s song
07.Into the abyss
08.Enchanted by the moon
09.A new day
10.Dead man’s dream (Bonustrack)
11.My future (Bonustrack – vinyl only)
Besetzung:
Tomi Joutsen – Vocals
Esa Holopainen – Lead Guitars
Tomi Koivusaari – Rhythm Guitars
Niclas Etelävuori – Bass
Santeri Kallio – Keyboards
Jan Rechberger – Drums
Für die Freunde der physischen Tonträger:
Es gibt neben der Standard-CD noch eine Box mit CD (inklusive Bonustrack) und Bonus-DVD (mit „Making of“ etc.) und die Vinyl-Ausgabe mit 2 Bonustracks und Poster im Gatefold (erhältlich in diversen Farben) und die obligatorischen „Nuclear Blast-Mailorder-Edition“ Box-sets.